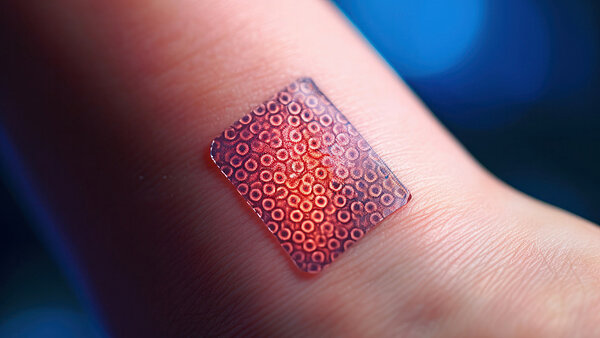Computer-Technologien bestimmen unser Leben. Doch viel zu oft werden diese an den Bedürfnissen der Menschen vorbei entwickelt. Susanne Bødker möchte dazu beitragen, diesen Missstand zu ändern. Die Informatikerin von der Universität Aarhus setzt sich für das sogenannte partizipatorische Design ein, das Nutzer:innen bei der Entwicklung von Technologien in den Mittelpunkt rücken will.
Wie das funktionieren kann, schildert die Expertin für Mensch-Maschine-Interaktion in einer Akademievorlesung am 21. September an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) in Wien. Erste Einblicke in ihren Vortrag, der so viele Bereiche unseres Alltags berührt, gibt Bødker im Interview.
Partizipatorisches Design
Sie sind eine Verfechterin von partizipatorischem Design. Was heißt das?
Susanne Bødker: Ich interessiere mich immer dafür, wie Technologie tatsächlich genutzt wird. Das deckt sich oft nicht mit den Vorstellungen, die Entwickler:innen und Hersteller haben. Wenn viele Menschen ein Produkt über lange Zeiträume nutzen, erlebt man immer wieder Überraschungen. Vorhersagen lässt sich so etwas nur sehr schwer. Partizipatorisches Design ist die Idee, die Nutzer:innen bei der Entwicklung neuer Technologien von Anfang an mit einzubeziehen. Diese Idee hat in der Forschung eine lange Tradition in den skandinavischen und deutschsprachigen Ländern. Dort wurde früh versucht herauszufinden, wie man den Nutzer:innen eine Teilhabe einräumen kann.
Begonnen hat das in den 70er-Jahren, als Akademiker:innen mit Arbeiter:innen und Gewerkschafter:innen gearbeitet haben, um neue Technologien am Arbeitsplatz zu integrieren. Das ging über die Frage, was die Nutzer:innen brauchen hinaus, es wurde auch diskutiert, welche Aktivitäten man setzen kann, um dem Management Verbesserungsvorschläge mitzuteilen. Wir haben schnell gelernt, dass es wichtig ist, Alternativen aufzuzeigen. Es gibt immer Wege, um eine Technologie besser und benutzerfreundlicher zu machen.
Das Wichtigste ist, dass die Hersteller nicht nur nach einer Bestätigung ihrer Ideen suchen, sondern bereit sind, die tatsächlichen Schwachstellen anzugehen."
Wie kann man die Partizipation gestalten?
Bødker: Es gibt ein breites Spektrum von Methoden. Für eine Firma wie Microsoft ist es schwierig, bei der Entwicklung von Office-Software partizipativ zu arbeiten, weil die Nutzer:innen über die ganze Welt verstreut und sehr heterogen sind. Partizipatorisches Design würde wahrscheinlich versuchen, Einsichten zu gewinnen, indem zumindest einige Nutzer:innen einbezogen würden. Aber selbst das ist nicht immer notwendig. Das Wichtigste ist, dass die Hersteller nicht nur nach einer Bestätigung ihrer Ideen suchen, sondern bereit sind, die tatsächlichen Schwachstellen anzugehen. Dabei muss man strategisch denken. Wenn man zum Beispiel wissen will, wie man Technologie besser ins dänische Schulsystem integrieren kann, ist es wichtig, Feedback von Schüler:innen und Lehrer:innen zu bekommen. Dafür muss man die Leute aber zuerst dazu bringen, sich mit der neuen Technologie zu beschäftigen. Wie man effiziente Feedbacksysteme baut, ist eine entscheidende Frage.
Impfzertifikate und Steuererhebung
Welche Beispiele zeigen, dass fehlende Einbeziehung der Nutzer:innen problematisch sein kann?
Bødker: Die dänische Verwaltung ist voll von Beispielen. Wir hatten eine COVID App, die unsere Impfzertifikate verwaltet hat. Das hat überhaupt nicht gut funktioniert. Oder ein neues System zur Grundsteuererhebung. Da wurden falsche Steuerbeträge berechnet und es war nicht einmal klar, wo man sich Beschwerden darüber einreichen konnte. Bei der Entwicklung wurde keinerlei Input von Nutzer:innen oder Steuerbeamt:innen eingeholt.
Warum werden die Nutzer:innen so selten einbezogen?
Bødker: Die meisten Entwickler:innen glauben zu verstehen, wie ihre Produkte genutzt werden. Jeder Softwareentwickler wird sagen, dass die Nutzer:innen wichtig sind, aber trotzdem werden sie praktisch nie gehört. Auch weil der Zeit- und Kostendruck normalerweise hoch ist. An meiner Uni wurde zum Beispiel ein neues System zur Abrechnung der Reisekosten eingeführt. Dabei wurden weder wir Akademiker:innen, noch die Verwaltungsmitarbeiter:innnen konsultiert. Natürlich sagt die Universität Aarhus, dass sie Nutzer:innen respektiert, aber in der Praxis passiert das nicht einmal hier.
Die alte Idee von Automatisierung ist immer noch am Leben."
Hat das auch mit der Silicon Valley Mentalität zu tun?
Bødker: Die alte Idee von Automatisierung ist immer noch am Leben. Da schwingt immer mit, dass die Manager:innen wissen, was am besten für die Arbeiter:innen ist. Das ist nicht so einfach zu ändern, weil Arbeiter:innen ihren Input auch nicht kostenlos zur Verfügung stellen wollen. Das ist immer ein Spannungsverhältnis.
Open-Source als Hoffnungsträger
Fallen Ihnen positive Beispiele für partizipatorisches Design ein?
Bødker: Positive Beispiele gibt es, aber meistens sind es nicht die Lösungen großer kommerzieller Anbieter, sondern Open-Source-Softwaresysteme, die lokal entwickelt wurden und dann eine größere Nutzer:innenbasis gefunden haben. Ich erinnere mich an eine sehr gute Unterrichtssoftware der Uni Hamburg, die dann auch von anderen Institutionen übernommen wurde.
Als Bürger:innen haben wir das Recht, einbezogen zu werden."
Ist es nicht beinahe unmöglich, alle Stakeholder bei der Entwicklung neuer Technologie miteinzubeziehen?
Bødker: Dafür ist es wichtig, Prozesse auf vielen politischen Ebenen zu haben. Wenn ich Software für Schulen entwickeln will, muss ich das mit nationalen und lokalen Politiker:innen besprechen und mit Verwaltungsbeamt:innen, Gemeinden, Direktor:innen, Lehrer:innen und Schulklassen. Dabei gibt es nicht eine Botschaft, sondern viele verschiedene Bedürfnisse. Wir müssen die Strukturen bauen, die eine Teilhabe überhaupt erst ermöglichen. Als Bürger:innen haben wir das Recht, einbezogen zu werden, aber dazu brauchen wir die Hilfe von Politiker:innen und den Herstellern der Technologie. Die Anbieter wissen oft nicht, welche Fragen man stellen sollte. Wenn etwas nicht funktioniert, heißt es meistens 'Die Nutzer:innen verwenden es falsch'. Wenn das stimmt, dann müssen die Hersteller den Benutzer:innen besser erklären, wie die Technologie funktioniert.
Sind KI-Systeme, denen Nutzer:innen mitteilen können, was sie brauchen, die Lösung?
Bødker: Man muss sich nicht lange damit beschäftigen, um zu sehen, dass das nicht funktioniert. Als mein Nachbar mir erzählt hat, dass er seine Reiseroute in die Niederlande mit Chat GPT geplant hat, habe ich ihm geraten, zu prüfen, ob die empfohlenen Orte überhaupt existieren. Diese Systeme haben eine sehr eigenwillige Beziehung zur Wahrheit und werden den Nutzer:innen deshalb nicht geben können, was sie wollen oder brauchen. Aber vielleicht können wir aus den Versuchen etwas lernen.